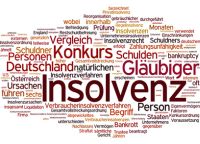Sinn und Zweck des Insolvenzverfahrens ist es, eine gemeinsame Befriedigung der vom Konkurs betroffenen Gläubiger zu erreichen. Was die Verwertung des Schuldnervermögens anbetrifft, gibt es zwei grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten: An erster Stelle zu nennen ist die Zerschlagung des Vermögens, der hieraus entstehende Erlös wird an die Schuldner verteilt. Andererseits wird aber oft auch eine Unternehmensfortführung angestrebt mit dem Ziel der Gewinnverteilung an die zuteilungsberechtigten Gläubiger. Im Bereich privater Insolvenz hat der Schuldner durch das Verfahren die Möglichkeit, nach sechs Jahren Wohlverhaltensphase die Restschuldbefreiung zu erlangen.
Die Besonderheit bei einem Insolvenzverfahren besteht darin, dass sich alle Gläubiger in einem geregelten Verfahren Zugriff auf das Schuldnervermögen verschaffen, weshalb in diesem Zusammenhang auch von Gesamtzwangsvollstreckung gesprochen wird. Den Gegensatz zum beschriebenen Verfahren der Insolvenz bildet die sog. Einzelzwangsvollstreckung. Unter Einbeziehung staatlicher Hilfsorgane (beispielsweise eines Gerichtsvollziehers) wird ein Zugriff auf das Vermögen des Schuldners versucht. Was die Vermögensverwertung anbetrifft gilt grundsätzlich das Prioritätsprinzip, was bedeutet, dass derjenige Gläubiger zuerst befriedigt wird, der als erster seine Ansprüche geltend gemacht hat. Wenn das Vermögen des Schuldners nun nicht mehr ausreicht um alle Gläubiger zu befriedigen entsteht oft ein Gläubigerwettlauf, da jeder Betroffene versucht, seine Ansprüche schnellstmöglich durchzusetzen. Da dies nicht im Sinne einer gerechten Verteilung sein kann und außerdem für den Fall eines Schuldners in unternehmerischer Form zur Zerschlagung des Unternehmens führen würde, sieht die deutsche Rechtsordnung hierfür das Institut der Gesamtvollstreckung vor.
Die beiden grundlegenden Ziele eines geregelten Insolvenzverfahrens ergeben sich aus den Ausführungen im vorherigen Absatz: Grundsätzlich soll eine gerechte Befriedigung der Gläubiger eines zahlungsunfähigen Schuldners auf dem Wege einer gemeinschaftlichen Vermögensverwertung erreicht werden. Für den Fall, dass es sich beim Schuldner um ein Unternehmen handelt, soll eine Unternehmensfortführung und -sanierung angestrebt werden.
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht zum Verfahren der Insolvenz in Deutschland. Das Hauptaugenmerk wurde dabei auf private Insolvenzen gelegt.
Eröffnung des Verfahrens nur auf Antrag...
Auf Basis der Rechtsvorschriften des §13 der Insolvenzordnung wird ein Insolvenzverfahren grundsätzlich nicht von Amts wegen, sondern nur auf Antrag eröffnet. Dieser Eröffnungsantrag hat beim zuständigen Insolvenzgericht zu erfolgen und kann sowohl vom Betroffenen selbst als auch von jedem beliebigen Gläubiger gestellt werden.
Was die Möglichkeit zur Verfahrenseröffnung anbetrifft, ist ein Gläubiger in seiner Entscheidung frei, was bedeutet, dass er keine Verpflichtung hat, einen Konkursantrag zu stellen. Der Schuldner hingegen kann sich unter bestimmten Umständen durchaus strafbar machen, wenn er seiner Antragspflicht nicht nachkommt. Das in diesem Zusammenhang oft zitierte Stichwort "Insolvenzverschleppung" kann für den Betroffenen durchaus ernsthafte straf- und haftungsrechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen.
Ist der Antrag gestellt so beginnt das Insolvenzeröffnungsverfahren. Sinn und Zweck dieses Verfahrens ist die Überprüfung der Zulässigkeit der Antragstellung sowie das Vorhandensein eines Eröffnungsgrundes. Des Weiteren muss das Gericht nun feststellen, ob das Schuldnervermögen ausreicht, um die entstehenden Verfahrenskosten zu decken. Gestaltet sich die Beantwortung der genannten Fragen nicht ganz so einfach wie erwartet wird oft ein vorläufiger Insolvenzverwalter eingesetzt. Dieser ist dann auch für die Sicherung des Schuldnervermögens und eine evtl. Betriebsfortführung verantwortlich. Der sog. Bestellungsbeschluss des Gerichtes regelt im konkreten Fall Befugnisse und Aufgaben des vorläufigen Insolvenzverwalters.
Annahme oder Ablehnung des Insolvenzantrags
Die Insolvenzeröffnung findet nicht statt, wenn das Gericht zu dem Schluss kommt, dass nicht genügend Vermögensmasse vorhanden ist und / oder kein ausreichender Insolvenzgrund vorliegt. Die Verfahrenseröffnung kann im Falle einer nicht ausreichenden Vermögensmasse dennoch stattfinden, wenn ein entsprechender Betrag zur Deckung der Verfahrenskosten in Vorleistung gebracht wird - in aller Regel geschieht dies durch einen Gläubiger.
Wenn sowohl ein Insolvenzgrund als auch ausreichende Vermögenslage festgestellt werden können, kommt es zur Verfahrenseröffnung durch das Insolvenzgericht. Das Gericht erlässt hierzu einen sog. Eröffnungsbeschluss und ernennt einen Insolvenzverwalter. Des Weiteren werden der Berichtstermin sowie der Prüfungstermin festgelegt.
Für die Gläubiger bedeutet das nun eingeleitete Verfahren, dass ihnen der Weg der Einzelzwangsvollstreckung gegenüber dem Schuldner nicht mehr zur Verfügung steht, die Verteilung des verbliebenen Vermögens geschieht nun durch Anwendung der Gesamtvollstreckung. Rechtlich geht mit der Verfahrenseröffnung das Verfügungsrecht bezüglich des Unternehmens- oder auch Privatvermögens vom bisherigen Vermögenseigentümer auf den durch das Gericht eingesetzten Insolvenzverwalter über.
Unternehmensfortführung oder Liquidation...
... dies ist unter anderem die Frage im Laufe des sog. Berichtstermins. Dieser Termin wird im Eröffnungsbeschluss zum Insolvenzverfahren festgesetzt. Eine wichtige Rolle spielt hierbei zunächst der Insolvenzverwalter. Er gibt seine Einschätzung zur gesamten Situation des betroffenen Unternehmens und rät als unmittelbare Schlussfolgerung aus dem festgestellten Unternehmenszustand zu Konsequenzen. Als Konsequenzen in Frage kommen die Auflösung des Unternehmens (Liquidation) und die Unternehmensfortführung. Welche der beiden genannten Varianten die sinnvollere ist hängt natürlich vom Einzelfall, aber auch vom Standpunkt des Betrachters ab.
Der Insolvenzverwalter hat im Zusammenhang mit der Klärung der Frage ob das Unternehmen fortgeführt oder liquidiert werden soll allerdings nur eine beratende Funktion. Die Entscheidung welche Variante im konkreten Fall zum Einsatz kommen soll, obliegt allein der Gläubigerversammlung. Diese ist als oberstes Selbstverwaltungsorgan des Insolvenzverfahrens konzipiert und besteht aus der Gesamtheit der Gläubiger. Die Mitgliedschaft ist wohlgemerkt optional, dies bedeutet, dass sich ein einzelner Gläubiger beteiligen kann, aber nicht muss.
Entscheidung der Gläubigerversammlung
Beschlüsse der Gläubiger-Versammlung werden mit der absoluten Mehrheit der Stimmen gefasst. Diese Stimmen werden unter den Gläubigern wohlgemerkt nicht per Kopf aufgeteilt, sondern entsprechend ihrer offenen Forderungen dem insolventen Unternehmen gegenüber. Entscheidungen getroffen werden zudem nur von den erschienen Gläubigern, die entsprechenden Vorschriften finden sich in §76 der Insolvenzordnung.
Trifft die Gläubigerversammlung die Entscheidung, dass eine Unternehmenssanierung der bessere Weg ist, so muss der Insolvenzverwalter gemäß den Vorschriften des §229 der Insolvenzordnung einen Sanierungsplan aufstellen. Ziel dieses Sanierungsplans muss die Wiederherstellung der Ertragskraft des betroffenen Betriebes sein, auf die Gläubigerbefriedigung aus den künftigen Gewinnen muss dabei besonderes Augenmerk gelegt werden. Wird dagegen eine teilweise oder vollständige Liquidation beschlossen, so hat der Insolvenzverwalter gemäß §35 der Insolvenzordnung die Aufgabe, unverzüglich die Vermögensverwertung in die Wege zu leiten.
Insolvenzforderungen im Falle der Liquidation...
... geltend zu machen ist das naheliegende und durchaus nachvollziehbare Ziel jedes Gläubigers. Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt wird im Rahmen des Berichtstermins entschieden, ob eine Unternehmensfortführung im Wege einer Sanierung möglich ist oder ob die Unternehmenszerschlagung unumgänglich ist. Wird der letztere Beschluss gefasst so kommt das Verfahren der Liquidation ins Laufen. Der nächste Schritt ist nun der sog. Prüfungstermin des Insolvenzverfahrens, bei welchem die Insolvenzgläubiger auf Basis der Vorschriften des §38 InsO ihre individuellen Ansprüche gegen die Insolvenzmasse geltend machen können. Die Forderungen müssen zuvor (spätestens bis zum Prüfungstermin) beim Insolvenzverwalter in eine sog. Forderungstabelle eingetragen werden (Basis §174 InsO). Für den gar nicht so seltenen Fall, dass ein Gläubiger seine Forderungen mit zeitlicher Verzögerung anmeldet, bestimmt das Insolvenzgericht auf Kosten des Einbringenden, welcher seine Forderung nicht rechtzeitig angemeldet hat, einen speziellen Prüfungstermin.
Überprüfung der Anspruchsgrundlage
Da - wie sie leicht erahnen lässt - nicht alle eingereichten Forderungen im Rahmen eines Insolvenzverfahrens unstrittig sind erfolgt nun die Prüfung der Rechtmäßigkeit des Anspruches. Die Prüfung aller eingereichten Insolvenzforderungen wird in gemeinsamer Arbeit durch die Gläubigerversammlung, den Schuldner und den Insolvenzverwalter erledigt. Für den Fall, dass die Anspruchsgrundlage einer Forderung nicht anerkannt wird, steht dem Forderungsinhaber die klageweise Feststellung des Bestehens der Forderung offen. Der Insolvenzverwalter erstellt nun die Forderungstabelle, diese enthält alle nicht bestrittenen oder auch durch ein Gerichtsurteil titulierten Forderungen. Die betreffenden Forderungsinhaber sind berechtigt an der Verteilung der Insolvenzmasse teilzuhaben.
Insolvenzmasse, Freie Aktiva, Kritische Masse und Teilungsmasse...
... sind wichtige Begriffe im Rahmen der Erlösverteilung nach Prüfungstermin und Verwertung des Schuldnervermögens. Aufgrund der Tatsache, dass durch den Insolvenzverwalter nur eine Bargeldauskehrung statthaft ist, ist die gesamte Vermögensverwertung hierfür als Voraussetzung obligat. Die Befriedigung der Gläubiger richtet sich nach deren Zugehörigkeit zu einer der verschiedenen Rangklassen, welche auf Basis der rechtlichen Stellung des Gläubigers erstellt werden. Die Befriedigung erfolgt von Rangklasse zu Rangklasse bis die Masse vollständig verwertet ist. Hierbei wird nach folgendem Schema vorgegangen:
Das Verfahren der Erlösverteilung im Überblick
Am Anfang der Verteilung steht das festgestellte Bruttovermögen des Unternehmens. Von diesem erfolgt als erstes der Abzug der mit einem Aussonderungsrecht behafteten Gegenstände. Ein derartiges Aussonderungsrecht (Recht auf Herausgabe) steht einer Person primär dann zu, wenn sie Eigentümer eines bestimmten Gegenstandes ist, welcher zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung im Besitz des Schuldners ist. Die aufgrund der Aussonderung entstehende Differenz wird als Insolvenzmasse bezeichnet. Von dieser werden nun wiederum alle mit einem Absonderungsrecht belegten Gegenstände abgezogen (Reservierung für betreffenden Gläubiger aufgrund der Behaftung mit einem oder mehreren Sicherungsrechten). Der aus der Absonderung entstehende Verwertungserlös wird an die betreffenden Gläubiger ausgekehrt. Des Weiteren muss natürlich der Gegenwert durch die beschriebene Aufrechnung entstehende Forderungsverlust von der Insolvenzmasse subtrahiert werden, wodurch sich ein verbleibendes Vermögen ergibt, das nun als freie Aktiva bezeichnet wird.
Auch ein Insolvenzverfahren kostet Geld, insofern ist leicht nachvollziehbar, dass auch diese Kosten (Insolvenzverwalter, Gerichtskosten etc.) in Abzug gebracht werden müssen. Dieser Abzug erfolgt von der Insolvenzmasse, der verbleibende Betrag, welcher positiv sein muss, damit dass Verfahren nicht mangels Masse abgewiesen wird, wird als kritische Masse bezeichnet. Als nächstes erfolgt der Anzug sonstiger Masseverbindlichkeiten - hierunter fallen primär Ansprüche aufgrund von Geschäften, welche vom Insolvenzverwalter im Zuge des Insolvenzverfahrens getätigt wurden - wodurch sich als Restbetrag die Teilungsmasse ergibt. Aus dieser Teilungsmasse erfolgt nun die Befriedigung aller unbesicherten Insolvenzgläubiger zuzüglich der besicherten Gläubiger, sofern Ihre Ansprüche im Rahmen des bisher beschriebenen Verfahrens (Absonderung und Aufrechnung) nicht vollständig befriedigt wurden. Die Aufteilung erfolgt in gleichen Quoten nach der Höhe der bis dato noch nicht befriedigten Forderung. Sollte nach dieser Verteilung noch ein Restbetrag übrig bleiben (wie sich erahnen lässt eher selten der Fall), wird die Restmasse der Befriedigung der nachrangigen Insolvenzgläubiger zugeführt.
Beendigung des Insolvenzverfahrens durch Aufhebungsbeschluss
Wie im vorangehenden Abschnitt verdeutlicht bildet die Verteilung des Vermögens den eigentlichen Kern des Insolvenzverfahrens. Nach Durchführung der Erlösverteilung erfolgt die offizielle Verfahrensbeendung durch Beschluss. Dieser Beschluss bezüglich Verfahrensaufhebung und -beendigung wird folgerichtig als Aufhebungsbeschluss bezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt erlangt der Schuldner wieder freie Verfügungsgewalt bezüglich seines Vermögens. Des Weiteren können nun alle rechtmäßigen Insolvenzgläubiger ihre ausstehenden Forderungen wieder ohne Einschränkung gegenüber dem Schuldner geltend machen. Die rechtliche Basis hierzu findet sich §201 InsO.
Restschuldbefreiung oder zwangsweise Liquidation
Nach Abschluss des Insolvenzverfahrens sind die weiteren Folgen davon abhängig, ob es sich beim Betroffenen um eine natürliche oder eine juristische Person handelt. Im ersteren Fall steht einer natürlichen Person die Möglichkeit der Restschuldbefreiung offen (Basis §§286 ff. InsO), welche nach Durchlaufen einer Wohlverhaltensphase von sechs Jahren den Weg zur Schuldenfreiheit ebnet. Diese Variante ist auch für den persönlich haftenden Gesellschafter eines insolventen Unternehmens möglich. Anders sieht die Situation bei juristischen Personen, Kapitalgesellschaften und Genossenschaften aus - hier steht die zwangsweise Liquidation und damit verbunden die endgültige Löschung auf dem Plan.